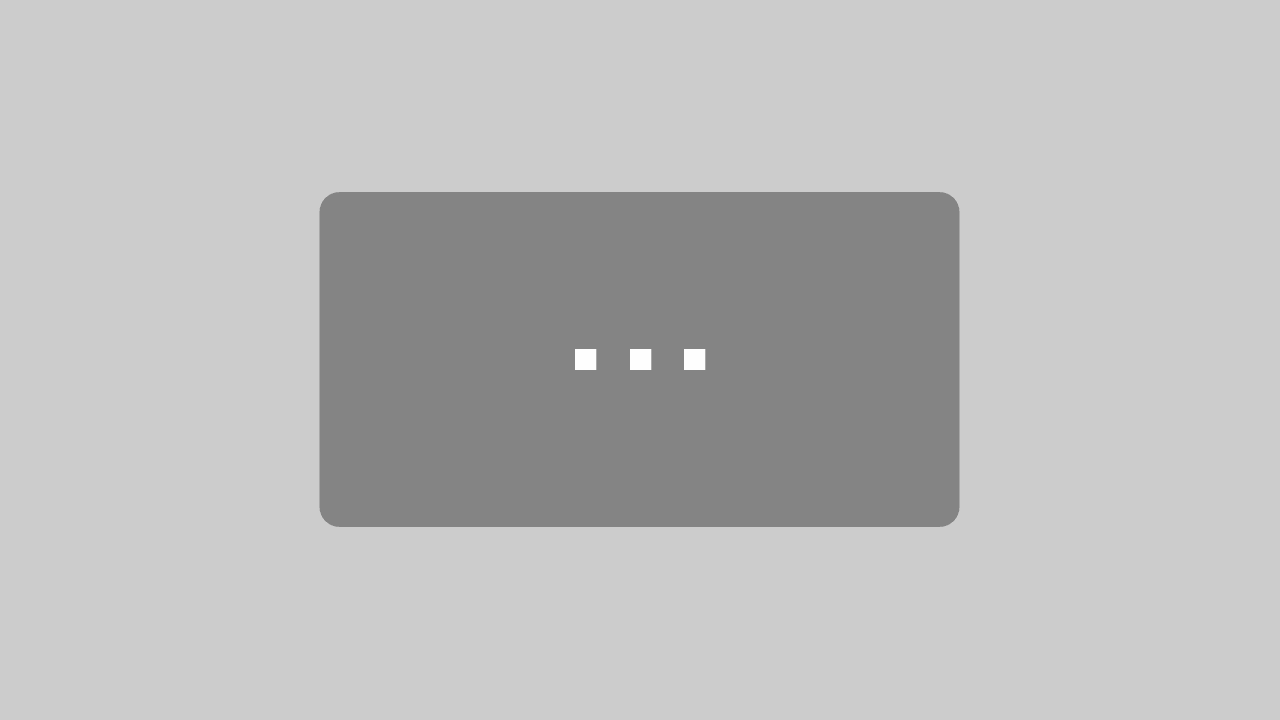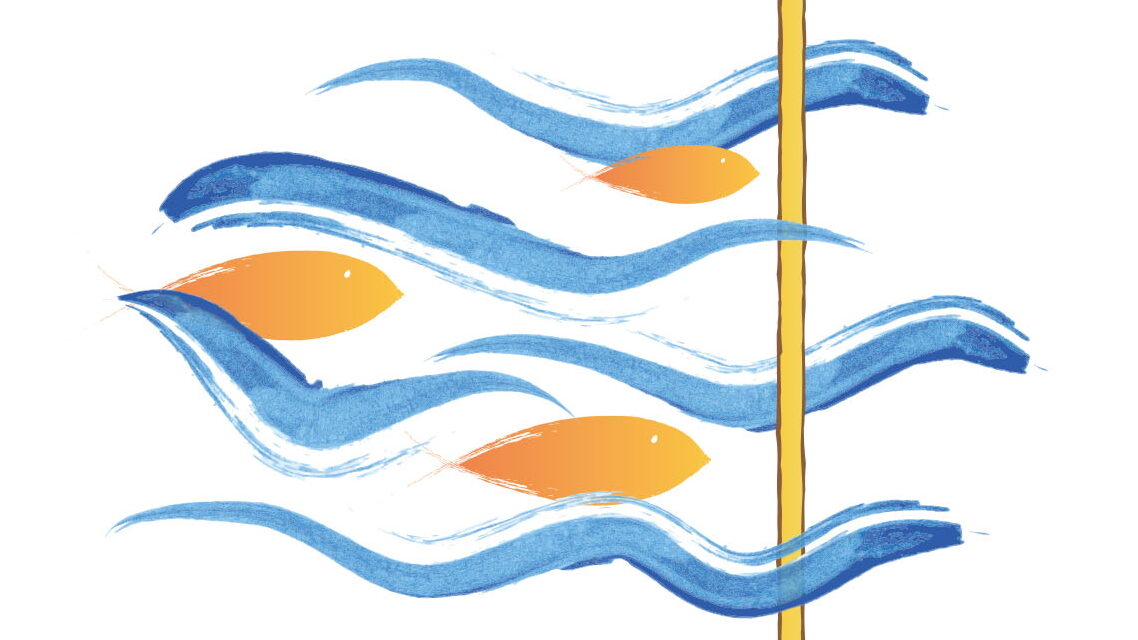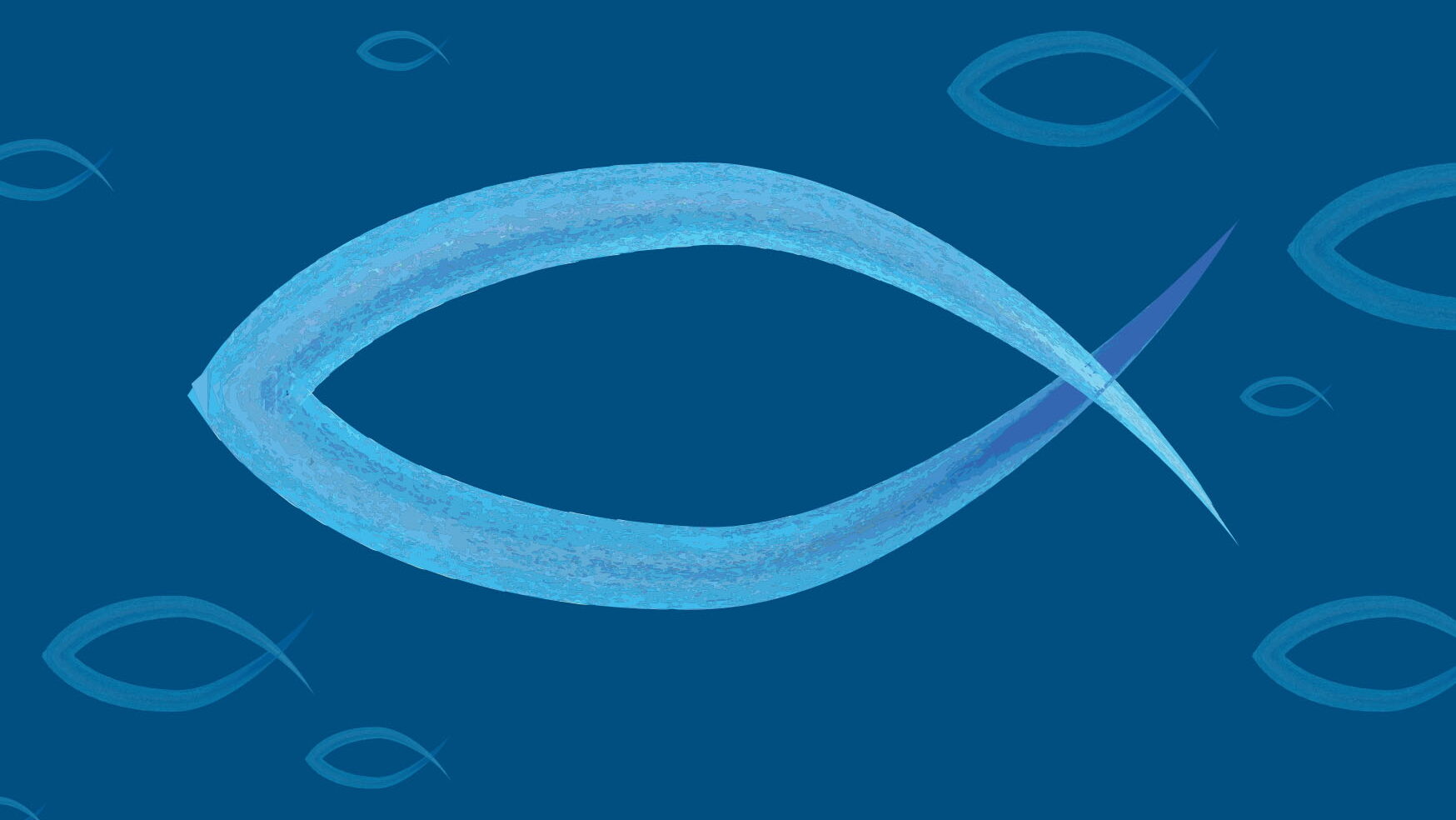Die Taufe ist das erste und grundlegende Sakrament der christlichen Gemeinschaft. Äußerlich steht sie für die Aufnahme in die katholische Kirche. Innerlich bedeutet das Sakrament eine Wandlung: Durch das Wasser der Taufe wird ein Mensch gereinigt und symbolisch wiedergeboren. Damit steht die Taufe für Erneuerung und eine spirituelle Transformation. Von nun an begleitet Gott den Menschen durch sein Leben, lässt ihm seine Liebe zuteilwerden, ist bei ihm, wenn es darauf ankommt.
Auf dieser Seite erfahren Sie Wissenswertes über die Taufe und finden weiterführende Informationen zu Namensgebung, Taufpaten und Sprüche zur Taufe.
Bedeutung der Taufe
Die Taufe ist ein besonderes Sakrament und gehört zu den ältesten Ritualen der Christenheit: Es ist der Wunsch der Eltern, ihr Kind unter Gottes Segen zu stellen. Die Taufe ist dabei die erste Begegnung mit Gott im Zeichen einer symbolischen Handlung. Mit diesem Sakrament wird das Kind in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen.
Biblischer Ursprung
Das Sakrament der Taufe hat eine besondere Bedeutung, weil es biblischen Ursprungs ist: Alle vier Evangelien erzählen, wie Jesus Christus durch Johannes den Täufer im Fluss Jordan getauft wurde. „Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.“ (Mt 3,16-17) Die Evangelien beschreiben die Taufe als Wendepunkt im Leben Jesu, denn danach beginnt er sein öffentliches Wirken.
Nach seiner Auferstehung gibt Jesus den Auftrag zu taufen an seine Jünger weiter. Die Taufe ist von Anfang an ein wichtiges Sakrament, das die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft symbolisierte. Sie ist aber auch Auftrag: Getaufte Christinnen und Christen sind dazu aufgerufen, ihr Leben an Jesus Christus auszurichten.
Die Geschichte der Taufe in der katholischen Kirche
Im ursprünglichen Wortsinn bedeutet Taufe „eintauchen“ – in den ersten Jahrhunderten wurde der Täufling ganz ins Wasser eingetaucht. Die Zeremonie fand damals an Flüssen oder in großen steinernen Becken, den Baptisterien, statt. Und getauft wurde man als Jugendlicher oder junger Erwachsener. Ab dem Mittelalter verbreitete sich die Taufe von Kleinkindern.
Heute ist es bei der Taufe üblich, dass der Taufspender – das ist in der Regel ein Priester oder Diakon – geweihtes Wasser dreimal über den Kopf des Täuflings gießt und dessen Stirn mit Chrisamöl einsalbt. Dabei spricht er folgende Taufformel: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Die Paten entzünden dann die Taufkerze an der Osterkerze. Und handelt es sich um die Taufe eines Kindes, wird ihm ein weißes Taufkleid angelegt.
Voraussetzung für den Empfang der weiteren Sakramente
Die Taufe ist Voraussetzung für den Empfang aller anderen Sakramente. Zusammen mit der Firmung und der Erstkommunion zählt sie zu den sogenannten Initiationssakramenten (Einführungssakramenten). Die Eingliederung in die Kirche ist also erst dann vollendet, wenn ein Mensch gefirmt ist und das Sakrament der Eucharistie empfängt.
 „Für mich war die Taufe meiner Kinder selbstverständlich. Mir liegt es sehr am Herzen, dass sie sich in ihrem Leben von Gott getragen und behütet wissen.“ (Svenja U.)
„Für mich war die Taufe meiner Kinder selbstverständlich. Mir liegt es sehr am Herzen, dass sie sich in ihrem Leben von Gott getragen und behütet wissen.“ (Svenja U.) „Wir haben unsere Kinder getauft, weil das Sakrament der Taufe für uns der Grundstein für die Verbindung unserer Kinder mit der Gemeinschaft der Kirche und Jesus Christus ist. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder ein christliches Leben führen und ihr Glaube, die Liebe, Hoffnung und Barmherzigkeit sie stets begleitet.“ (Kathrin B. und Marius H.)
„Wir haben unsere Kinder getauft, weil das Sakrament der Taufe für uns der Grundstein für die Verbindung unserer Kinder mit der Gemeinschaft der Kirche und Jesus Christus ist. Wir wünschen uns, dass unsere Kinder ein christliches Leben führen und ihr Glaube, die Liebe, Hoffnung und Barmherzigkeit sie stets begleitet.“ (Kathrin B. und Marius H.)