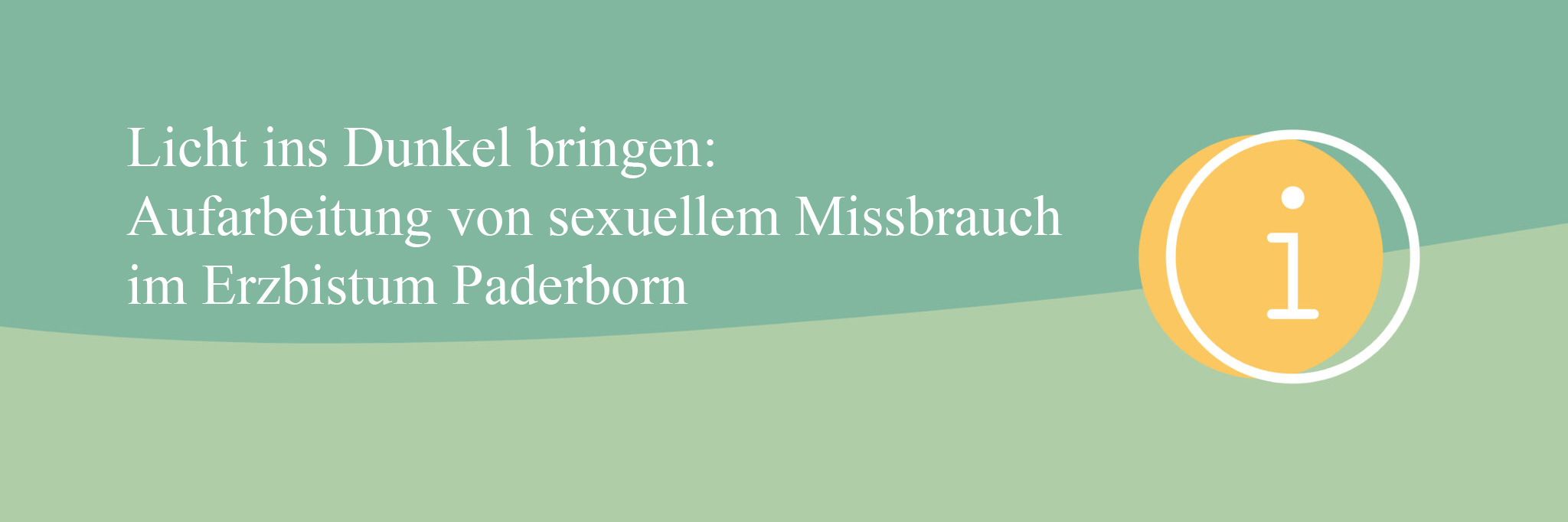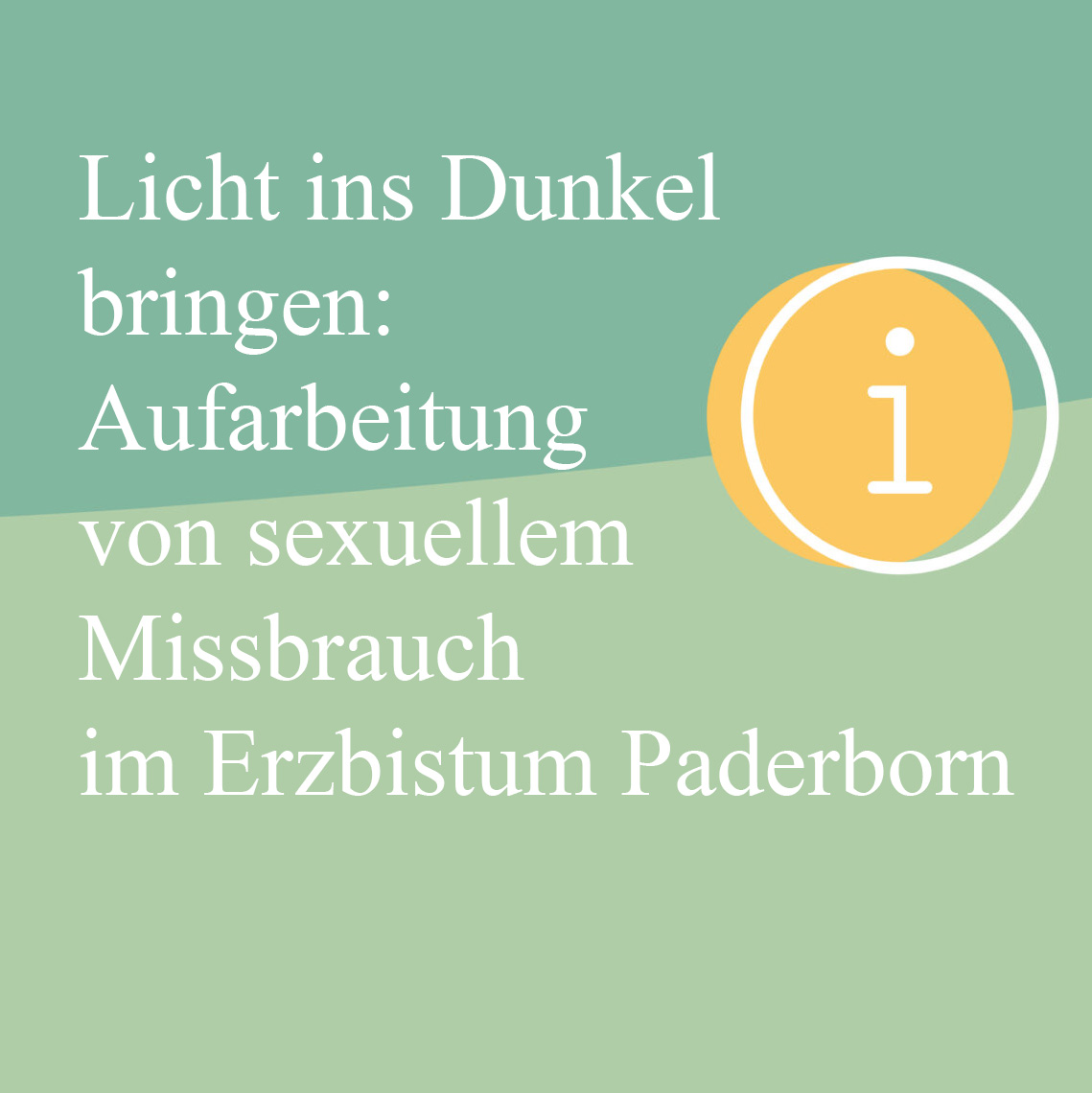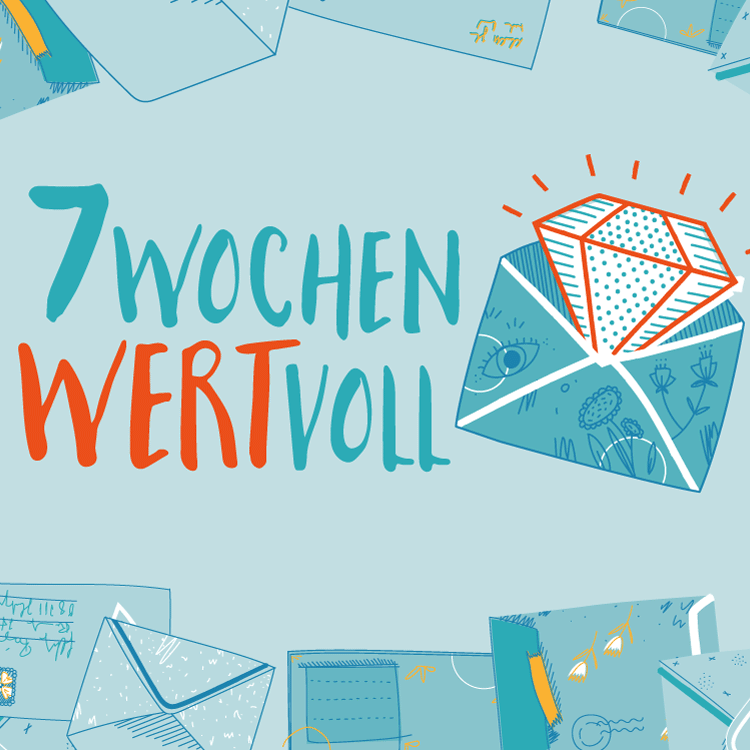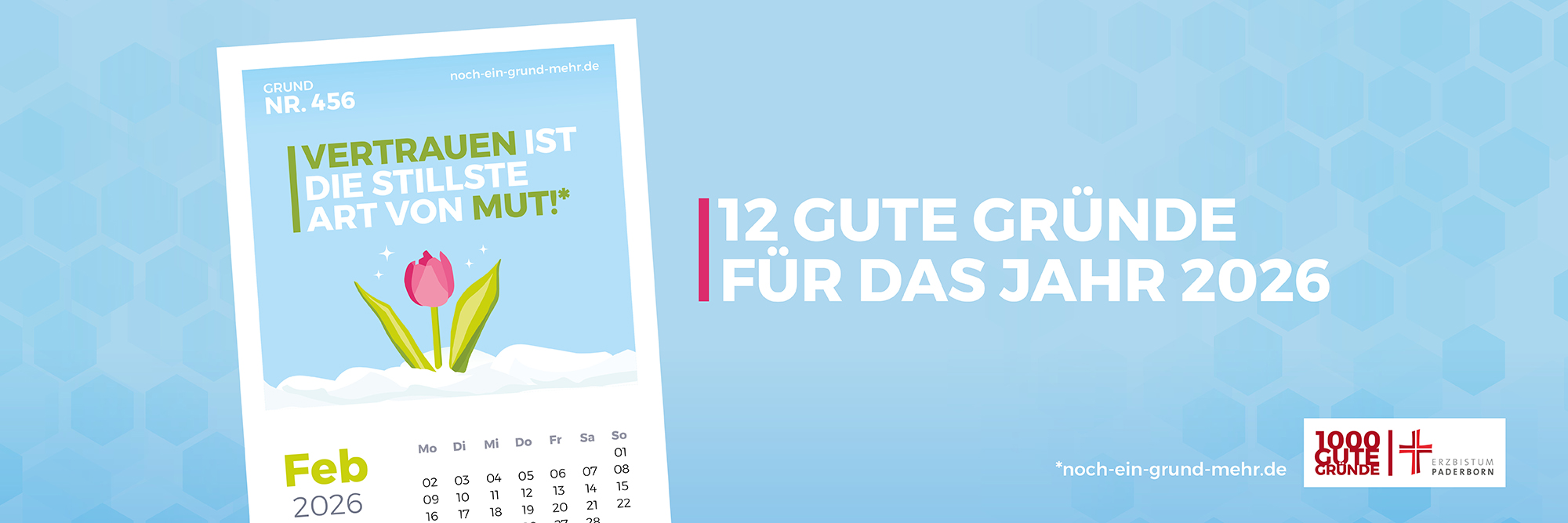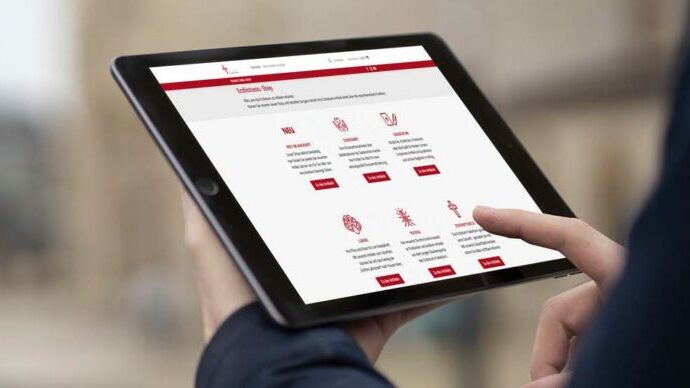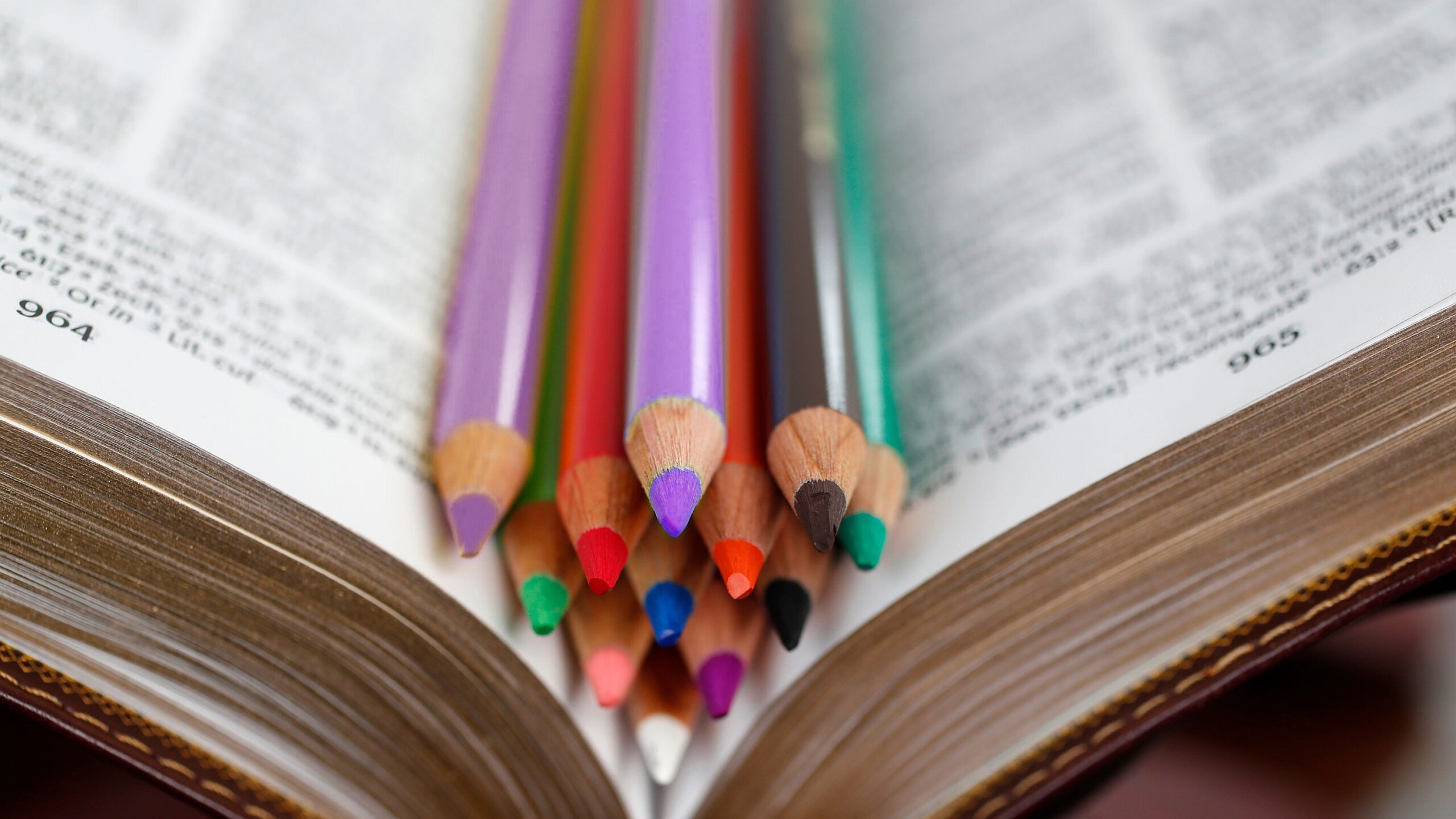Berlin/Düsseldorf (KNA) Nach der Einigung von Bund und Ländern hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine rasche Umsetzung der Krankenhausreform angekündigt. Jetzt könne der Wandel der Krankenhauslandschaft vor Ort umgesetzt werden, sagte Warken der "Rheinischen Post". Sie betont ...
Berlin/Düsseldorf (KNA) Nach der Einigung von Bund und Ländern hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine rasche Umsetzung der Krankenhausreform angekündigt. Jetzt könne der Wandel der Krankenhauslandschaft vor Ort umgesetzt werden, sagte Warken der "Rheinischen Post".
Sie betonte, dass die grundsätzlichen Ziele der Reform beibehalten würden. "Wir wollen mehr Spezialisierung, mehr Bündelung von Kapazitäten und damit eine Erhöhung der Behandlungsqualität", sagte sie. "Auf der anderen Seite erwarten die Menschen die Sicherstellung einer Grund- und Notfallversorgung auch in ländlichen Regionen."
Krankenhäuser und Krankenkassen zeigten sich am Freitag erleichtert, dass nun Planungssicherheit geschaffen werde. Zugleich zeigten sie sich unzufrieden mit einzelnen Regelungen und mahnten weitere Verbesserungen an.
Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, erklärte, die jetzt erzielten Ergebnisse ermöglichten den Bundesländern, ihre Krankenhausplanung umzusetzen und erste Projekte zu starten. Nach mehr als drei Jahre dauernden Verhandlungen sei allerdings nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer gelingenden Transformation der Krankenhauslandschaft auf den Weg gebracht worden.
Gaß begrüßte insbesondere, dass den Krankenhäusern mehr Flexibilität bei der Zuweisung von Leistungsgruppen zugestanden worden sei. Sehr kritisch bewertete er die sogenannte "Klarstellung zum Pflegebudget". Es drohten neue Unsicherheiten und Auseinandersetzungen zwischen Krankenhäusern und Kostenträgern. Der Chef der Krankenhausgesellschaft betonte, es gebe noch große Baustellen: Bürokratie und Überregulierung blieben ebenso auf der Agenda wie die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Krankenhausversorgung. Das 2020 eingeführte Pflegebudget soll die Zahl und die Entlohnung der Pflegekräfte in Krankenhäusern erhöhen. Kliniken können die Kosten für Pflege seitdem unbürokratisch und weitgehend ungeprüft mit den Krankenkassen abrechnen.
Die katholischen Krankenhäuser in Deutschland sehen die Einigung kritisch. "Der Kompromiss löst vielleicht den politischen Zank, substanziell leichter wird die Umsetzung der Krankenhausreform in der Praxis dadurch aber leider nicht", sagte Geschäftsführerin Bernadette Rümmelin am Freitag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin.
Vor allem bei der Finanzierung müssten die Kliniken nun ein neues System im Blindflug einführen, erläuterte sie. "Dabei ist schon jetzt klar: Die Vorhaltevergütung hält nicht, was sie verspricht, nämlich die Kliniken aus dem ökonomischen Hamsterrad zu befreien und die flächendeckende Versorgung zu sichern. Sie zielt vielmehr einseitig darauf ab, Leistungsangebote zu konzentrieren und Strukturen abzubauen. Die Folge ist Wartelistenmedizin." Kritik übte Rümmelin auch an der geplanten Regelung zum Pflegebudget. Sie werde vor allem zu mehr Bürokratie und Auslegungsstreitigkeiten zwischen Kliniken und Krankenkassen führen.
Eine gemischte Bilanz zog auch die Krankenkasse AOK: Die ursprünglich konsequenten Qualitätsvorgaben für die Krankenhäuser seien jetzt "löchrig wie ein Schweizer Käse", sagte die Vorstandsvorsitzende Carola Reimann. So könnten künftig Leistungsgruppen bis zu sechs Jahre lang auch an Krankenhäuser zugewiesen werden, die die damit verbundenen Qualitätskriterien gar nicht erfüllten.
"Trotzdem ist dieser Kompromiss für uns akzeptabel, weil die Krankenkassen in diese Entscheidungen eingebunden werden müssen", sagte Reimann. "Und die Einigung ist wichtig, weil damit der Vermittlungsausschuss abgewendet werden konnte und es nun endlich Planungssicherheit für alle Beteiligten gibt."
Positiv sieht Reimann die Regelungen zum Pflegebudget. Hier werde endlich klargestellt, dass Tätigkeiten, die nichts mit der unmittelbaren Pflege am Patienten zu tun haben, nicht mehr länger über das Pflegebudget finanziert werden dürften.
Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern sieht vor, dass Klinikstandorte bis Ende des Jahres spezialisierte Leistungen ausüben dürfen, ohne sich mit den Krankenkassen absprechen zu müssen. Danach sollen Ausnahmegenehmigungen an Krankenhäuser auch ohne die Erfüllung von Qualitätskriterien zweimal für drei Jahre erteilt werden dürfen.