Willkommen auf dem Glaubens- und Informationsportal des Erzbistums Paderborn
Unsere Nachrichten

Erzbistum Paderborn unterstützt wissenschaftliche Aufarbeitung der Causa Hengsbach

Prachtvolle Handschrift aus der Prager Burg in Paderborn eingetroffen

Pfarrer Ulrich Frobel verstorben

Im St.-Ursula-Gymnasium Arnsberg wird Platz geschaffen

Neues Kirchenvorstandsrecht tritt in nordrhein-westfälischen (Erz-)Diözesen in Kraft

Paradiesvorhalle für vier Tage geschlossen
Unsere Videos
Berufung in der Kirche
In diesem Video stellen wir dir eine neue Gemeindereferentin und einen neuen Pastoralreferenten im Erzbistum Paderborn im Porträt vor: Gemeindereferentin Henrike Buschulte und Pastoralreferent Johannes Andreas Lange erzählen, warum sie diesen Beruf gewählt haben und was ihre persönliche Leidenschaft ist. Diese beiden wurden durch Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz in den pastoralen Dienst als Gemeindereferentin und Pastoralreferent gesendet.
Schulstart-Aktion mit Schirmherr Erzbischof Dr. Bentz
Der Schulstart ist aufregend, manchmal aber auch ziemlich einschüchternd. Genau da setzt die Schulstart-Aktion des Erzbistums Paderborn an. Sie trägt den Titel „Jedes Kind braucht einen Engel“ und soll den Grundschulkindern zeigen: Du bist nie allein! Schirmherr der Aktion ist Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz. Vor Ort macht er sich ein Bild davon, wie es den Lehrkräften und Grundschulkindern geht und wie das Erzbistum helfen kann.
Alles dreht sich. Hektik. Lernen. Social Media.
Hektik und Stress im Alltag. Und ja keine Party verpassen. Jakoba hat öfter das Gefühl, dass sich im Alltag alles dreht. Doch wo sind Ruhe und Gelassenheit. Zeit für mich? Für Jakoba: in der Kirche. Davon erzählt ihr Kurzfilm, den sie im Rahmen der Firmvorbereitung im Pastoralverbund Büren gestaltet hat.
Veranstaltungen im Erzbistum Paderborn
- 22.10.2024(Dienstag) – 24.10.2024(Donnerstag)
- 10:00 – 15:00 Uhr
- Diözesanmuseum PaderbornDomplatz33098 Paderborn
Gottesdienst inklusiv feiern – Vertiefungskurs
- 23.10.2024(Mittwoch)
- 09:30 – 17:00 Uhr
- Bildungs- und Tagungshaus LiborianumAn den Kapuzinern 5-733098 Paderborn
Herbstaktion für Kinder
- 24.10.2024(Donnerstag)
- 09:30 Uhr
- Geistliches Zentrum FranziskusPaderborner Str. 733154 Salzkotten
Kirchliche Nachrichten aus Paderborn und Deutschland
Ticker der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA)
Theaterlegende Nele Hertling wird für ihr Lebenswerk geehrt
Berlin/Gera (KNA) Die Theaterdirektorin Nele Hertling (90) erhält in diesem Jahr den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" für ihr Lebenswerk. "Die Nachricht von dem Preis für das Lebenswerk hat mich überrascht und gefreut", erklärte Hertling am Dienstag in Berlin. Es sei ein Preis, der aus der "Erfahrung und der Kompetenz des Theaters" selber entschieden werde und die "großartige Vielfalt des Theaters" heute sichtbar mache.
Hertling wurde 1934 in Berlin geboren und kam als Kind mit ihrer jüdischen Mutter in einem Pfarrhaus in Mecklenburg unter. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Danach arbeitete sie frei für Rundfunk und Theater. Sie verbrachte den Großteil ihres Lebens in Berlin: zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Akademie der Künste in West-Berlin, deren Vizepräsidentin sie von 2006 bis 2015 war. 1988 gestaltete sie das Programm der Kulturhauptstadt Europas. Von 1989 bis 2003 leitete sie das Hebbel-Theater und war damit die erste Theater-Intendantin in Berlin.
Der Deutsche Theaterpreis wird vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder vergeben. Die Preisvergabe findet am 16. November im Theater Altenburg Gera statt.
Oxfam: Lieferkettengesetz keine unnütze Bürokratie
Berlin (KNA) Das deutsche Lieferkettengesetz ist nach Einschätzung der Entwicklungsorganisation Oxfam mehr als ein "nice-to-have" und keine unnütze Bürokratie. Wenn ein Gesetz die Möglichkeit schaffe, dass Arbeitskräfte gerecht bezahlt würden, "sollte ein Bundeskanzler und SPD-Politiker dieses Gesetz verteidigen - und nicht dem Störfeuer der Wirtschaftsverbände nachgeben", forderte die Organisation auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Dienstag in Berlin. Eine Verwässerung des Gesetzes gefährde jeglichen Fortschritt zum Schutz der schwächsten Glieder in der Lieferkette.
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor beim Arbeitgebertag laut Medienberichten verkündet, dass es beim nationalen Lieferkettengesetz bis Jahresende spürbare Entlastungen für Unternehmen gebe. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erwiderte, er glaube dies erst, wenn die Tinte trocken sei. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte in den vergangenen Monaten der Wirtschaft deutliche Änderungen an der bestehenden Lieferkettensorgfaltspflicht zugesagt, da es absehbar eine EU-weite Regelung gebe. Habecks Idee, die nationale Regelung auszusetzen, stieß bei Nichtregierungsorganisationen jedoch auf große Kritik. Auch Juristen äußerten erhebliche Bedenken an diesem Vorschlag.
Das seit zwei Jahren geltende deutsche Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen ab einer Größe von 1.000 Mitarbeitern zur Einhaltung bestimmter Sorgfaltspflichten. Ziel ist, dass menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken vermieden oder beendet werden. Die deutsche Wirtschaft beklagt einen bürokratischen Aufwand der Regelung und fordert Änderungen. Vergangene Woche war indes ein Antrag aus der Union zur Aufhebung des Lieferkettengesetzes im Bundestag gescheitert.
Die im Frühjahr verabschiedeten EU-Richtlinien zu weltweiten Lieferketten sind an einigen Stellen weniger, an anderen schärfer als die deutsche Gesetzgebung, so bei den Sanktionen. Die 27 EU-Staaten müssen die Richtlinie nun innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht überführen.
Niedersachsen will Strafen für sexuelle Belästigung durch Worte
Hannover/Berlin (KNA) Niedersachsen will sich dafür einsetzen, dass sexuelle Belästigung durch Worte oder Gesten bundesweit strafbar wird. Die Landesregierung beschloss am Dienstag, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundesrat einzubringen. Ziel sei, insbesondere Frauen und Mädchen künftig besser vor Angriffen auf ihre sexuelle Selbstbestimmung zu schützen, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte.
"Viel zu viele Mädchen und Frauen müssen bislang erleben, dass Männer sie mit Worten oder Gesten zum bloßen Sexualobjekt degradieren", erklärte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). "Solche Belästigungen sind nicht harmlos - und schon gar kein Kompliment. Damit muss endlich Schluss sein."
Konkret will die Landesregierung sexuell belästigende Äußerungen und damit vergleichbare nonverbale Verhaltensweisen unter Strafe stellen, wenn sie die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten. Der Entwurf sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor.
Niemand solle für einen verunglückten Flirtversuch bestraft werden, so Wahlmann. "Aber genauso hat niemand das Recht, Frauen und Mädchen ungefragt mitzuteilen, dass er sie nur als Objekte seiner sexuellen Fantasien ansieht. Ich habe deshalb absolut kein Verständnis, wenn zum Beispiel erwachsene Männer minderjährige Mädchen lautstark und in obszöner Weise zu sexuellen Handlungen auffordern."
Ärzte: Deutsche Krankenhäuser auf Krieg kaum vorbereitet
Berlin (KNA) Deutschlands Gesundheitssystem ist nach Meinung von Ärzte-Vertretern unzureichend auf einen möglichen militärischen Konflikt vorbereitet. "Die deutschen Krankenhäuser haben hinsichtlich der Versorgung von Kriegsverletzungen einen erheblichen Nachholbedarf", sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dietmar Pennig, am Dienstag in Berlin. Lediglich die fünf Bundeswehrkrankenhäuser seien hierzulande mit besonderen Kenntnissen ausgestattet.
Wenn auch deutsche Soldaten im Krieg kämpfen müssten und Deutschland Aufmarschgebiet würde, wäre mit vielen Hunderten Toten und Tausenden Verletzten zu rechnen, unterstrich Pennig beim Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die vorgehaltenen Betten der Bundeswehrkrankenhäuser und der damit verbundenen Unfall-Kliniken wären innerhalb von 48 Stunden ausgelastet, wie es hieß.
Nach Angaben des Generalsekretärs wurden mehr als 1.200 verletzte Soldaten aus der Ukraine seit Kriegsbeginn in deutschen Krankenhäusern aufwändig, langwierig und kostenintensiv behandelt. "Die Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken mussten sich auf die neuen Verletzungsmuster einstellen, viele Kliniken gingen finanziell in Vorleistung." Erst kürzlich habe die Bundesregierung 50 Millionen Euro für die Versorgung von Kriegsverletzten aus der Ukraine zur Verfügung gestellt.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im März in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärt: "Es wäre albern zu sagen, wir bereiten uns nicht auf einen militärischen Konflikt vor. Nichtstun ist keine Option."
Bischof Overbeck verteidigt Frauenpredigt im Bistum Essen
Vatikanstadt (KNA) Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck hat sich am Rande der Weltsynode der katholischen Kirche im Vatikan für die Frauenpredigt stark gemacht. Bei einem Pressebriefing am Dienstag sagte er: "Wir müssen weiter über die Rolle der Frau in der Kirche nachdenken und wir müssen Frauen auch zur Predigt zulassen."
Auf Nachfrage erklärte er, dass in seinem Bistum wegen des erheblichen Priestermangels schon heute Frauen die Predigt hielten und Gottesdienste leiteten, und das nicht nur für Kindergruppen. Auch in Gemeinden, wo ausländische Priester ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse als Pfarrer eingesetzt würden, predigten mitunter Frauen.
Overbeck führte weiter aus, die katholische Kirche in Deutschland habe noch keine umfassende Antwort auf den gravierenden Priestermangel gefunden. Sie müsse ihre Rolle und ihre Struktur neu definieren in einer Gesellschaft, die mehrheitlich gottfern lebe und denke.
Zum Umgang der Kirche mit Angehörigen sexueller Minderheiten sagte Overbeck, in diesem Bereich habe sich in den vergangenen 50 Jahren sehr viel verändert. Auch die Kirche habe seit 20 oder 30 Jahren begonnen, sich damit auseinanderzusetzen. Vieles habe sich dabei auch für die Kirche geändert. Entscheidend sei auch auf dem Gebiet der Sexualmoral der Grundsatz, dass nicht die Kirche die Menschen rette, sondern Gott.
Polnischer Literaturpreis für Monika Helfer
München (KNA) Monika Helfer (77), österreichische Schriftstellerin, hat in Polen den Angelus-Literaturpreis erhalten. Die mit 150.000 Zloty (fast 35.000 Euro) dotierte Auszeichnung wurde ihr für den Roman "Die Bagage" (2020) zuerkannt, wie der Hanser-Verlag am Dienstag in München mitteilte. Die Preisverleihung fand demnach am 19. Oktober in Breslau (Wroclaw) statt. Der Angelus-Literaturpreis wird jährlich an das bedeutendste Prosawerk eines Autors aus Mitteleuropa verliehen, das im Vorjahr auf Polnisch erschienen ist.
"Wir haben ein herausragendes Buch ausgezeichnet - intim, familiär, universell", so das Jurymitglied Justyna Sobolewska. "Es ist ein Zeugnis gegen Gewalt, Ausgrenzung und Verachtung. Diese Prosa verschont niemanden."
Nach Verlagsangaben erzählt Helfer in dem Roman die Geschichte ihrer eigenen Herkunft: Am Rand eines Bergdorfes lebt eine arme Familie, die "Bagage". Im Ersten Weltkrieg wird der Vater zur Armee eingezogen. Die Mutter und ihre Kinder bleiben zurück. Eines Tages kommt ein Mann aus Hannover in die Gegend und klopft bei der Familie an die Tür. Die Mutter wird erneut schwanger, ihr Mann wird nie ein Wort mit diesem Kind sprechen. Dieses Kind, Grete, war Monika Helfers Mutter. Für das Werk hatte die Autorin bereits 2020 den Publikumspreis des Bayerischen Buchpreises erhalten.
Erzbistumsfinder
















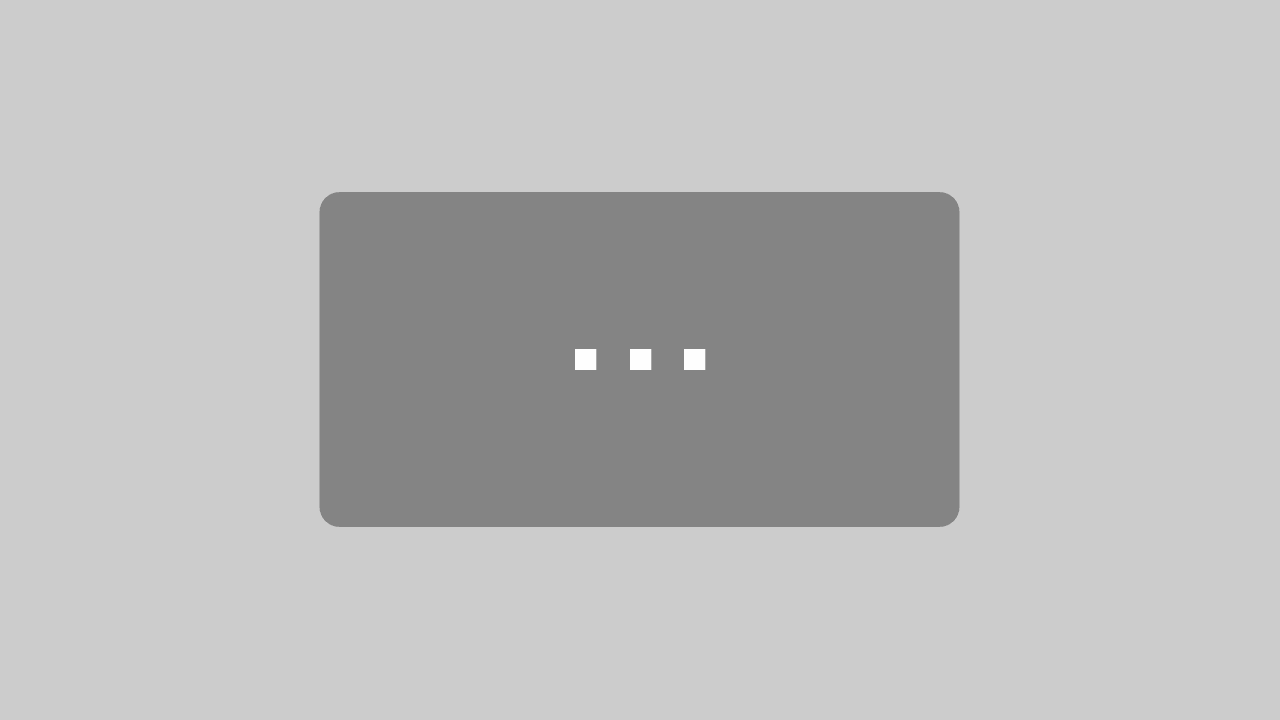





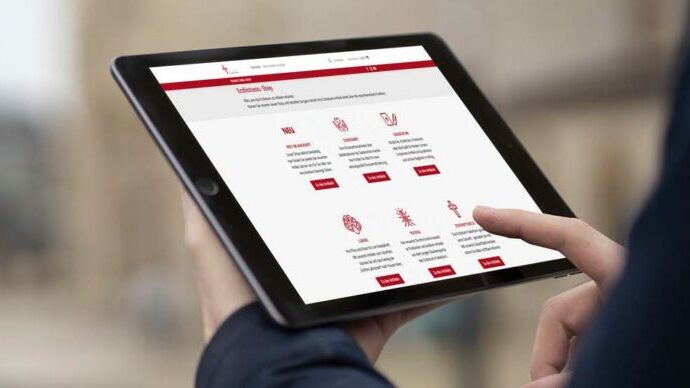






Das Erzbistum auf Instagram
Erzbistum Paderborn
21. Oktober 2024 | 16:06
...Dem Sprichwort nach soll man den Wert eines Buches nicht an seinem Einband bemessen. Doch im Fall des „Evangeliars des Prager Doms“ fallen historische Bedeutsamkeit und prunkvolle Verzierung eindrucksvoll zusammen: zwei mit byzantinischer Seide bespannte Eichenbretter, die Elfenbeintafel mit einer Darstellung des Apostels Paulus, vergoldete Zierplatten mit Figuren von tschechischen Heiligen – bei dieser Handschrift wurde keineswegs gespart.
Das Paderborner Diözesanmuseum war stolz darauf, diesen Prachtband willkommen heißen zu dürfen, damit er die bereits laufende Sonderausstellung „Corvey und das Erbe der Antike“ ergänzen kann. Gemeinsam mit Pater Monsignore Vladimír Kelnar und Michala Vraná aus Prag konnten der Paderborner Dompropst Joachim Göbel und der Direktor des Diözesanmuseums, Dr. Holger Kempkens, die wertvolle Handschrift aus dem Veitsdom heute in ihre Ausstellungsvitrine legen.
Wer nun mehr über die Relevanz des über tausend Jahre alten Evangeliars für Corvey erfahren möchte, kann bis zum Ausstellungsende beim Besuch im @dioezesanmuseum_paderborn über die Kunstfertigkeit staunen.
#erzbistumpaderborn #diözesanmuseum #corvey #prag #evangeliar #handschrift #buchkunst #kirchengeschichte
Erzbistum Paderborn
19. Oktober 2024 | 07:25
...Wir wünschen Ihnen und Euch ein gutes und farbenfrohes Herbst-Wochenende. Vielleicht scheint die Sonne ja so schön wie auf diesem Foto hier. Viel Freude bei euren Aktivitäten! 🙏🍂
#herbst #brakel #kreuz
Erzbistum Paderborn
17. Oktober 2024 | 06:24
...„Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken.“ (Gen 9,16)
Einen wunderschönen guten Morgen aus Paderborn 🙌🏻 #paderborn #regenbogen #dom #paderbornerdom
Erzbistum Paderborn
15. Oktober 2024 | 12:50
...Das Erzbistum Paderborn eröffnet für die Mitmachaktion GLÜCKLICH/T SEIN! extra ein eigenes Café? Naja, nicht so ganz... 😅 Doch im Gemeindezentrum von St. Joseph in Bünde gibt es seit anderthalb Jahren tatsächlich ein Café, das ebenfalls "Glück-Licht" heißt. Und dort wird richtig tolle Arbeit geleistet gegen Einsamkeit und Trauer, auch wenn der Start recht schwierig verlief. Also erfolgte ein inhaltlicher Neustart in diesem Sommer.
Seit der Erweiterung der Zielgruppe von den Trauernden auf von Einsamkeit betroffene Menschen wird das Café Glück-Licht mittlerweile gut angenommen, verrät uns Gemeindereferent Ulrich Martinschledde. Nicht nur aufgrund der Namensähnlichkeit nimmt er mit dem Café in diesem Jahr an unserer Mitmachaktion GLÜCKLICH/T SEIN! teil - darüber freuen wir uns sehr.🙏
Für die Gäste hat er bereits Lichttüten, Postkarten und Lichtgläser bestellt und wird diese als Deko oder Weihnachtsgeschenk benutzen. Auch spielt er mit dem Gedanken, eine Spendentüten-Aktion zu organisieren. „Gerade die Ärmeren und Älteren oder Menschen, die gesundheitlich nicht mehr so fit sind, haben große Freude daran, wenn sie selbst etwas Gutes tun und zumindest auf diese Weise anderen Menschen helfen können.“
Wenn ihr mehr über GLÜCKLICH/T SEIN! oder das Café in Büde erfahren wollt, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei.
Erzbistum Paderborn
12. Oktober 2024 | 06:01
...Für die Schulkinder und ihre Familien in NRW beginnen mit diesem Wochenende die Herbstferien. Und auch das Lehrpersonal darf durchatmen und für den Endspurt des Kalenderjahres Kraft tanken.
Unser Ratespiel variieren wir heute etwas: Wer erkennt diese Kirche nur anhand ausgewählter Figuren, die zahlreich im Innenraum verteilt sind?
Schöne Ferien für alle, die sie genießen können - und ein schönes Wochenende! 🚴♀️🚴♂️
#erzbistumpaderborn #nrw #warburg #höxter #herbstferien #architektur #skulpturen #kirche #katholisch #schöneswochenende
Erzbistum Paderborn
11. Oktober 2024 | 10:25
...Mit insgesamt 500.000 Euro aus Mitteln des Katstrophenfonds unterstützt das Erzbistum Paderborn die humanitäre Hilfe für notleidende Menschen in Gaza. Das Hilfswerk @malteserinternational erhält 250.000 Euro für den Einsatz eines mobilen Hospitals. Hilfsgütertransporte in die Krisenregion werden durch das Erzbistum Paderborn mit Zuwendungen in Höhe von jeweils 125.000 Euro an die Malteser International und @caritas_international gefördert. Dadurch werden Hilfsgüterlieferungen beider Organisationen für den Zeitraum von sechs Monaten mit ermöglicht.
Bei der Vollversammlung der @bischofskonferenz hat der Paderborner Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz im September zu Spenden für die wichtige Arbeit der Hilfsorganisationen im Gazastreifen aufgerufen. Jetzt setzt der Vorsitzende der DBK-Arbeitsgruppe Naher und Mittlerer Osten ein deutliches Zeichen der Solidarität.
Weitere Informationen, auch zur konkreten Arbeit der Organisationen vor Ort, findet ihr über den Link in der Bio auf unserer Homepage. 📋
#erzbistumpaderborn #erzbischofbentz #gaza