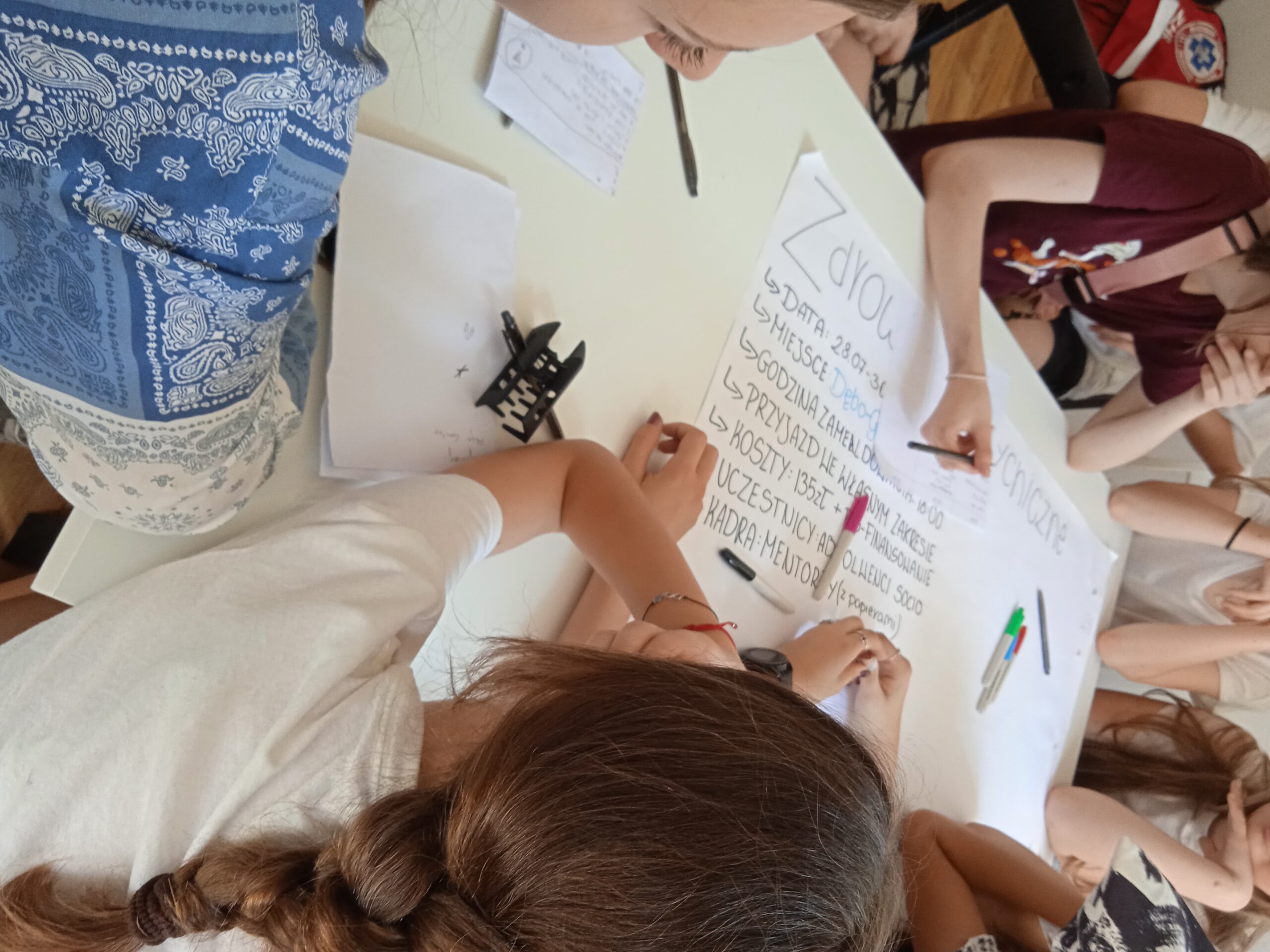Die europäische Idee ist groß und wunderschön: Menschen leben miteinander in Frieden und Freiheit, teilen gemeinsame Werte von Gleichheit, Toleranz und Solidarität, genießen ihren Wohlstand, ihre Rechte und den Reichtum vielfältiger Kulturen. Aber keine Idee ist so groß und so schön, dass sie nicht beschmutzt, kleingeredet, verächtlich gemacht und zerstört werden könnte. Europa ist europamüde geworden. Zumindest behaupten das die Rechtspopulisten, die Europaskeptiker und Nationalisten – und zwar so lange, bis ihre selbsterfüllende Prophezeiung Wirkung zeigt.
Jemand, der sich hauptberuflich für die europäische Idee einsetzt und gegen die Dauerbeschallung von Rechtsaußen stemmt, ist Gregor Christiansmeyer. Der 27-jährige Geschichtswissenschaftler und Politologe arbeitet im Fachbereich „Jugendsoziales Engagement in Europa“ bei der Kommende Dortmund, dem Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn. Aber was macht er in dieser Position den lieben langen Arbeitstag? Und worum geht es überhaupt beim jugendsozialen Engagement? Wozu ist es gut?