30. August 2020
8.40 Uhr – 9 Uhr, WDR 5
von Professorin Dr. Bergit Peters
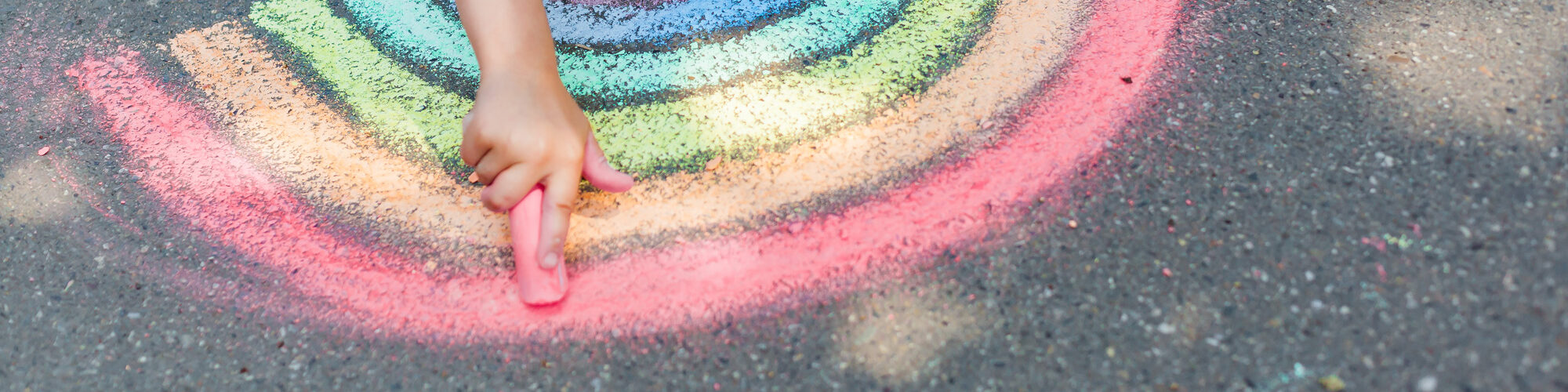

30. August 2020
8.40 Uhr – 9 Uhr, WDR 5
von Professorin Dr. Bergit Peters

Guten Morgen!
In diesem Jahr ist ja alles anders – coronabedingt. Als Hochschullehrerin in Paderborn war ich zum Homeoffice gezwungen. Überhaupt wurde der Lebensradius eingeschränkt. Um dabei körperlich und seelisch nicht einzugehen, habe ich mich durch Radfahren fit gehalten. Auf den zahlreichen Radtouren ist mir dann ein Symbol immer wieder aufgefallen: Der Regenbogen. Nein – nicht als Naturschauspiel am Himmel, sondern als fröhlich-bunte Kinderzeichnung im Fenster oder mit Malkreide auf dem Asphalt. Die Kinder, die in diesen Monaten auch viel Zeit zu Hause verbringen mussten, weil Kitas und Schulen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen blieben, verbinden eine Botschaft mit ihren Regenbogenbildern: „Bleibt zuhause. Wir tun es auch – und irgendwann wird alles wieder gut.“
„Alles wird gut.“ – Ein Satz, an dem auch ich mich in schwierigen Zeiten gern festhalte. Ein Satz, mit dem wir uns gegenseitig Mut machen können. Doch was ist, wenn er gar nicht stimmt? Ist die Wahrheit nicht eher die, dass niemand weiß, ob es tatsächlich gut wird?

„Alles wird gut.“ Dieser Satz, so lese ich in einem Wochenmagazin [1], entwickelte sich in der Corona-Krise regelrecht zur Trost- und Beschwörungsformel. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe auch ich vom ersten Tag der Krise an – als nämlich unsere katholische Hochschule geschlossen wurde – damit gerechnet, dass der Spuk in ein paar Wochen vorüber sein würde und wir – wie gewohnt – den Lehrbetrieb schon bald wieder aufnehmen würden. Und genau so wie ich mir von Anfang an die Zeit des danach in bunten Farben ausgemalt habe, so scheinen es auch viele andere getan zu haben, wenn es sehnsuchtsvoll hieß: „Wenn das Schlimmste vorbei ist.“ „Wenn die Normalität wieder zurückkehrt.“ „Wenn die Bundesliga wieder losgeht.“ – Solche Sätze erzählten scheinbar wie selbstverständlich davon, dass wir schon in einigen Wochen wieder zurück sein werden in unserem normalen Alltag, im gewohnten Leben.
„Alles wird gut.“ – Doch ist die Wahrheit nicht eher, dass niemand weiß, ob es gut wird? Denn wer sollte uns dies versprochen oder garantiert haben? Wer hat uns in Aussicht gestellt, dass alles gut wird?
Die Wahrheit ist doch eher die, dass nichts für immer Bestand hat. Letztlich wandelt sich alles oder geht sogar unter, verschwindet, wird zerstört oder zerstört sich selbst. Alles, was wir heute für selbstverständlich oder sogar für unverzichtbar halten, wird es eines Tages nicht mehr geben, wird sich gewandelt oder sogar in sein Gegenteil verkehrt haben – vor allem, wenn es um Staaten, Ideologien, Grenzen, Technologien und auch Religionen geht.
Zugegeben: Auch mir fällt es nicht leicht, diese Perspektive des Wandelns zuzulassen. Denn sie führt mir zum Beispiel vor Augen, dass mein kleines Glück und die vergangenen Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstands letztlich eine Ausnahme sind; ein Sonderfall in der Weltgeschichte. Und dies ist – so meine ich – doch der eigentliche Schock dieser Pandemie: Sie konfrontiert mich mit einer Wahrheit, die viele Menschen bisher erfolgreich verdrängt haben. Die Wahrheit ist doch: Unser Glück ist zerbrechlich, unsere Zivilisation gefährdet und unser Leben endlich.
Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und die Wahrheit hinter der Wahrheit sehen: Nur eine solche Gesellschaft kann zukunftsfähig und menschlich sein, die das Scheitern, die Negativität, den Tod und das Sterben nicht verdrängt, sondern als zum Leben dazugehörig akzeptiert und integriert. Einfacher formuliert: Es geht mir darum, trotz allem – das große Ganze zu sehen!
[1] Vgl. Süddeutsche Zeitung Magazin, Nummer 19, 08. Mai 2020, München.

Das große Ganze sehen – trotz allem. Trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und aktiv mitzuhelfen, sie zu gestalten. Das ist eine echte Herausforderung.
Von einem Mann, der sich dieser Herausforderung gestellt hat, erzählt ein Text, der am heutigen Sonntag in den katholischen Gottesdiensten aus der Bibel vorgetragen wird: Es geht um den Propheten Jeremia. Der greift Gott scharf an, denn er fühlt sich von Gott getäuscht und betrogen. Immerhin: In Gottes Namen hatte er zum Volk Israel gesprochen, es ermahnt und es vor Kriegskatastrophen gewarnt. Doch er findet kein Gehör bei dem Volk. Im Gegenteil: Er wird stattdessen verfolgt, reingelegt und verspottet. Was muss das für ein Gott sein, der ihn, Jeremia, zwar in Dienst nimmt, aber ihn dann auch hängen lässt?! Und doch kann Jeremia nicht von Gott lassen. Seine innere Bindung an Gott ist offensichtlich so stark, dass er an Gott dranbleibt und Gottes Wort weiter verkündet. Offenbar glaubt er, dass dieser Gott doch immer noch zu ihm hält und ihm seine rettende Hilfe nicht versagen wird, wenn er – Jeremia – an Gottes Aufgabe festhält.
Mir imponiert diese Lebenshaltung des Propheten Jeremia: Trotz alledem an Gott festzuhalten, trotz Scheitern, trotz Negativität, trotz Tod und Sterben. Jeremia zeigt mir eine Haltung, die durch und durch von einem Gedanken geprägt ist: Gott ist da. Diese Lebenshaltung ist natürlich kein Garant, dass mein Leben gelingt; sie schützt auch nicht vor schmerzlichen Erfahrungen und bitteren Enttäuschungen; vielmehr verlangt sie von mir auch noch jede Menge Vorschuss an Vertrauen. Und dennoch halte ich sie für eine mögliche Sinnperspektive, unter der ich mein ganzes Leben, eben mit allem Positiven und auch Negativen, annehmen und gestalten kann: Das große Ganze sehen, denn Gott ist da.
Jeremia hat dies getan. So kann er seine Klage am Ende sogar noch mit einem Aufruf beenden, Gott zu loben: „Singt dem Herrn, rühmt den Herrn; denn er rettet das Leben …“ (Jer 20,13). Wird am Ende doch alles gut? Jeremia wird schließlich nach Ägypten verschleppt, wo sich seine Spuren verlieren. Und dennoch stärkt er das Vertrauen in Gottes rettendes Eingreifen. Sein Lob ist für mich so etwas wie ein Ringen mit dem eigenen Glauben, wie ein verzweifelndes Vertrauen: Ja, am Ende wird es doch gut. Und so wird das Lob zu einer Brücke, die Not zu überwinden.
Ähnlich wie der Prophet Jeremia kennt die jüdische Schriftstellerin Natalia Ginzburg auch ein inneres Ringen zwischen Verzweifeln und Vertrauen angesichts ihrer Lebensgeschichte. 1916 in Palermo geboren, geht sie mit 24 Jahren aus politischen und ethnischen Gründen in die Verbannung. Sie lebt drei Jahre lang von 1940-43 mit ihrem Mann Leone und den gemeinsamen Kindern in den Abruzzen, diesem kargen und schwer zugänglichen Gebirgszug in der Mitte Italiens, versteckt während der Zeit der Besatzung durch die deutschen Truppen. 1944 foltern deutsche Soldaten Leone Ginzburg in einem römischen Gefängnis zu Tode. Er war Dozent für russische Literatur und als Sozialist verdächtig. Natalia Ginzburg hat noch im selben Jahr ihre Erinnerungen an die gemeinsame Abruzzenzeit aufgeschrieben. Und am Ende des Krieges hat sie dann den Text „Die kleinen Tugenden“ [2] verfasst. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie mit ihren Kindern in Turin und beobachtet rückblickend die schwere Zeit des Exils. Auf sehr persönliche Weise kreisen Ginzburgs Gedanken um ihre Kinder: Was sollen sie über das Leben lernen? Ihrer Kindheit wurde im Exil die Unschuld genommen. Sollte man sie belügen, um sie zu schützen oder mutet man ihnen die Wahrheit zu, ohne dass sie bitter werden oder zynisch oder resignieren?
Dies sind schwere Fragen. Sie lassen sich nicht so einfach beantworten.
Pointiert formuliert sie:
Man kann nur die Dinge erzählen, die man von innen kennt.
Und immer wieder fragt sie sich, wie bleibt man Mensch für andere Menschen? Welche Werte lebt man in schwierigen Zeiten? Und welche Tugenden bleiben, in einer unübersichtlichen Welt?
Natalia Ginzburg hält nicht viel von den oftmals hochgelobten so genannten kleinen Tugenden; sie mögen im Alltag durchaus ihre Verdienste haben, aber aufs große Ganze gesehen plädiert sie dafür:
die Kinder nicht die kleinen Tugenden [zu] lehren, sondern die großen. Nicht Sparsamkeit, sondern Freigiebigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Geld; nicht Vorsicht, sondern Mut und Verachtung der Gefahr; nicht Schlauheit, sondern Freimütigkeit und Wahrheitsliebe; nicht Diplomatie, sondern Liebe zum Nächsten und Selbstlosigkeit; nicht das Streben nach Erfolg, sondern das Streben nach Sein und Wissen. [3]
Natalia Ginzburg denkt nicht klein, sondern plädiert dafür, das Ganze zu sehen. So verstehe ich auch einen weiteren Gedanken, der mich fasziniert, weil er mir besonders in schwierigen Zeiten eine Orientierung gibt. Es geht darum Kindern zu helfen, ihren Weg, ihre Berufung zu finden. So schreibt sie:
Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir haben, um ihnen bei ihrer Suche nach einer Berufung behilflich zu sein, dass wir selbst eine Berufung haben, sie kennen, lieben und ihr leidenschaftlich dienen: Denn die Liebe zum Leben weckt die Liebe zum Leben. [4]
Die Liebe zum Leben weckt die Liebe zum Leben. Ich denke mir: So einmal das große Ganze sehen, als Ermutigung, auch der eigenen Berufung auf die Spur zu kommen; das eigene Leben anzunehmen mit seinen Licht- und Schattenseiten und es mutig zu gestalten. Oder im Sinne des Jeremia: Das große Ganze sehen, denn Gott ist da.
Dass Sie in diesen schwierigen Zeiten – allen Herausforderungen zum Trotz – das große Ganze sehen können, wünscht Ihnen aus Paderborn Bergit Peters.
[2] Natalia Ginzburg, Die kleinen Tugenden, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2020.
[3] Natalia Ginzburg, Die kleinen Tugenden, Berlin 2020, 137.
[4] Natalia Ginzburg, Die kleinen Tugenden, Berlin 2020, 154.