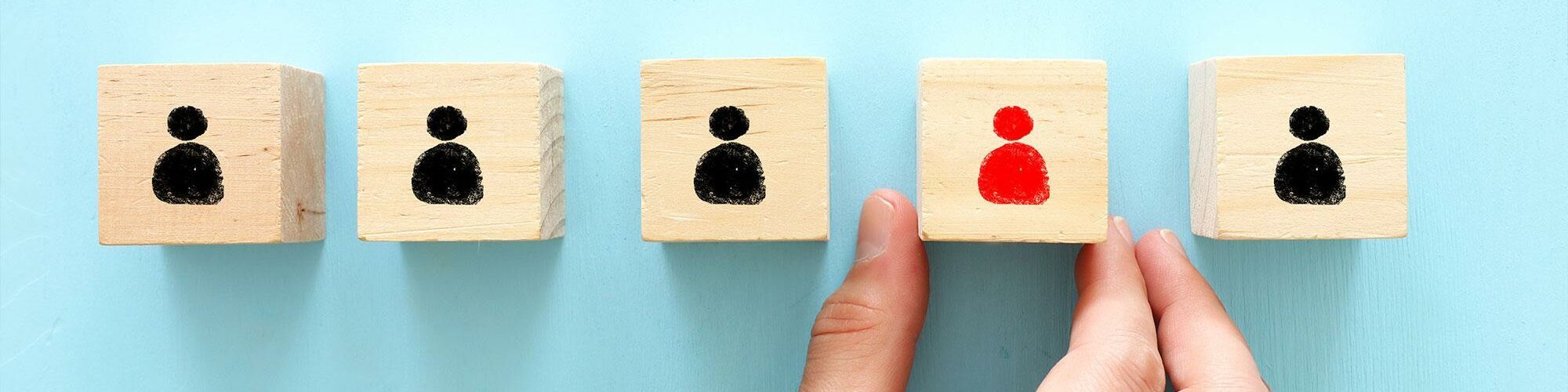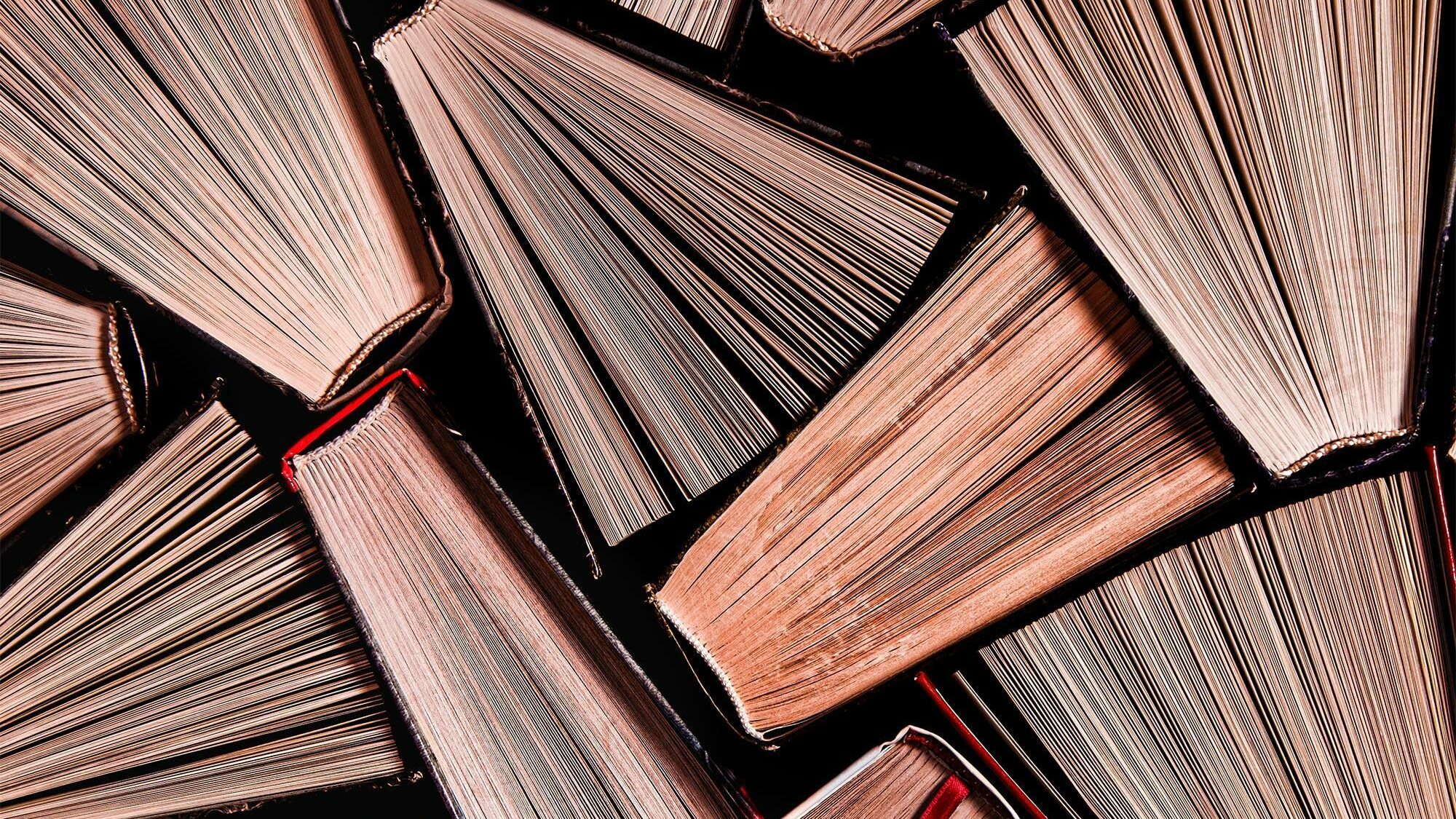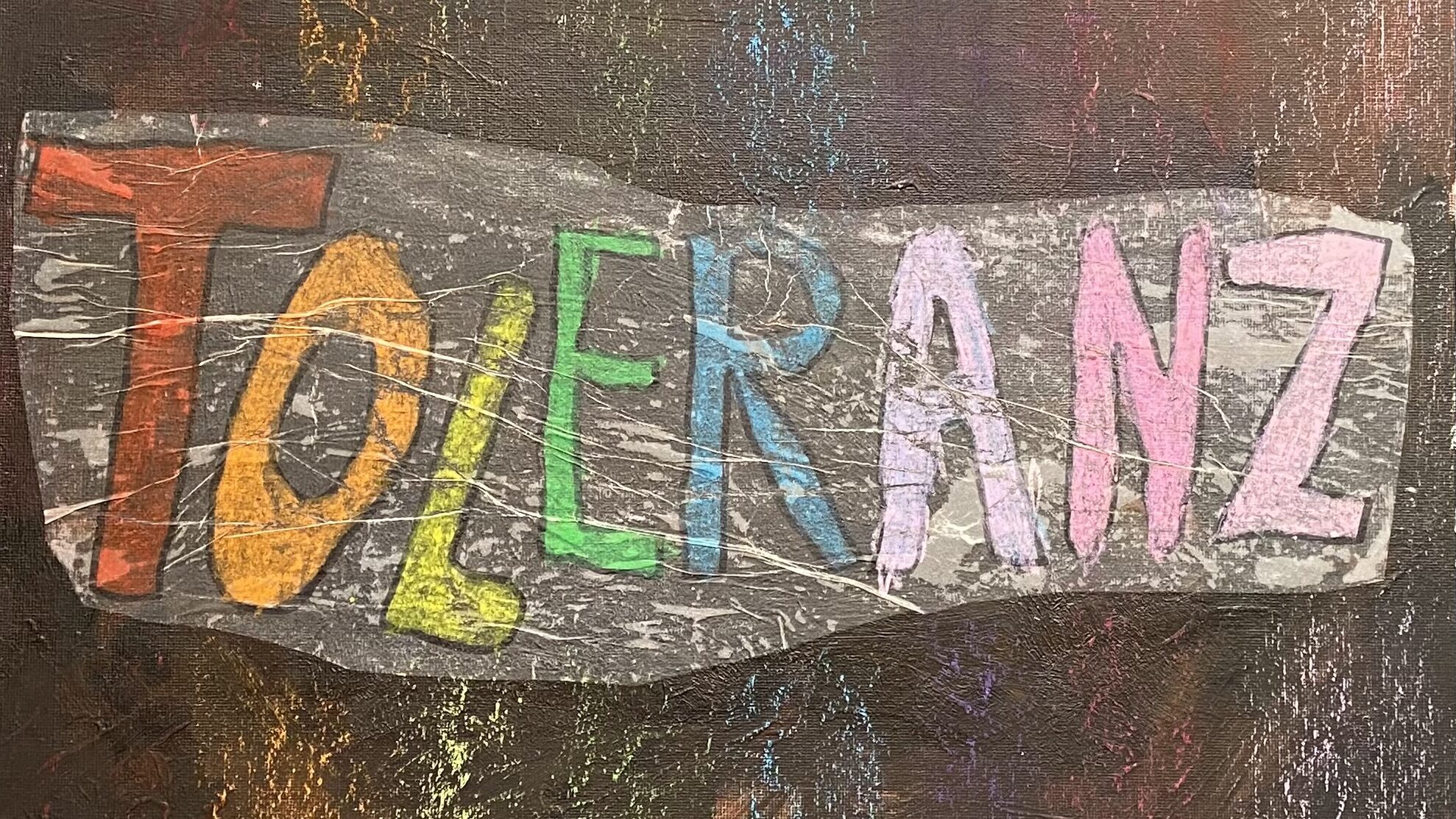Interview mit Julia Kroker, Leiterin der Abteilung Personal, über den Frieden im EGV
Der Tag im Büro beginnt mit einem lockeren Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeeküche, die Arbeit ihm Team ist fair verteilt und wenn es einmal stressig wird, kann ich auf die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen bauen. Für viele sieht wohl so oder so ähnlich der optimale Büro-Alltag aus. Doch in den wenigsten Büros herrschen immer Friede, Freude, Eierkuchen.
Wir haben daher mit Julia Kroker, Leiterin der Abteilung Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat, gesprochen und sie gefragt, was eine gute, friedliche Stimmung im Team ausmacht, was man tun kann, wenn die Stimmung einmal kippt und was die Corona-Pandemie für einen Einfluss auf die Dienst-Gemeinschaften hat.